Kurs 3: Digitale Medienformate in der Unterrichtspraxis
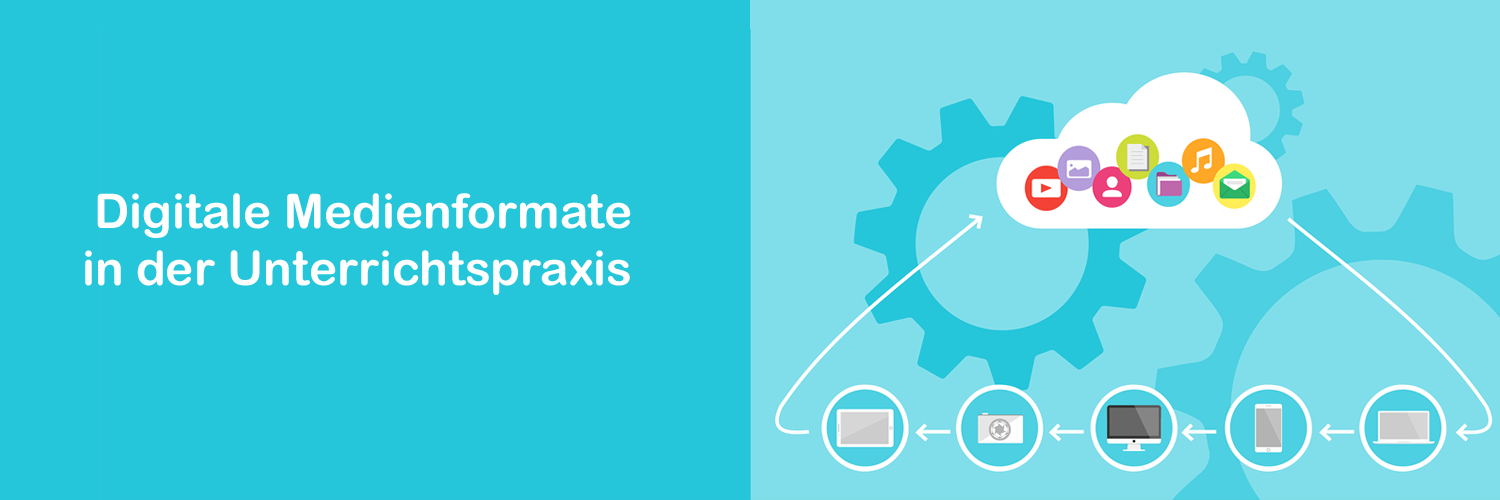
Worum geht es in dieser Lerneinheit?
Die verantwortliche Nutzung von digitalen Medien ist heutzutage unerlässlich. Aber wie können angehende Lehrkräfte die verschiedenen digitalen Medienformate in einem schlüssigen Gesamtkonzept organisieren? Diese Lerneinheit wird dich genau dabei unterstützen und deine Fähigkeiten für eine systematische Medienbildung stärken.
Diese Kompetenzeinheit wird dir einen umfangreichen Überblick über digitale Medientypen und deren Einsatz im Schulalltag geben. Fokus liegt hierbei nicht nur auf der Vermittlung wichtiger theoretischer Grundlagen, sondern auch auf der praktischen Anwendung. Thematisch unterteilt wird die Lerneinheit durch drei Kernbereiche:
(1) → Audiomedien
(2) → Film und Fernsehen
(3) → Computer und Internet
Viel Spaß!

Willkommen zum ersten Teilbereich – den Audiomedien.
Der Einsatz akustischer Medien kommt vor allem im Deutsch- und Fremdsprachenunterricht zum Einsatz.
Einsatz von Audiomedien im Deutschunterricht:
- Hörbücher als Ergänzung zum Literaturunterricht
- Einstieg in Dramenlektüre
Einsatz von Audiomedien im Fremdsprachenunterricht:
- Verstehen gesprochener Texte (Wörter, Sätze, Szenen)
- Schulung der Aussprache durch akustisches Vorbild
- Kommunikationssituationen nachvollziehen können
- aktive Mitgestaltung als Teilnehmende:r bei einer Kommunikationssituation fördern
Bei näherer Betrachtung der curricularen Vorgaben von Lehrplänen wird schnell ersichtlich, dass nur selten Verweise auf Hörmedien und die damit verknüpften spezifischen Chancen und Anforderungen vorzufinden sind. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die ästhetische Qualität und die didaktischen Potenziale von Hörmedien vermehrt in Vergessenheit geraten.
Theoretische Grundlagen: Die Didaktik des Hörens
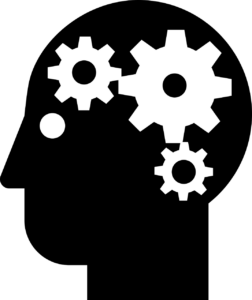 Das Auge hat sich im täglichen Leben zum dominanten Sinnesorgan entwickelt. Demgegenüber ist das Ohr und damit das Hören ein eher untergeordnetes Sinnesorgan. Verstärkt wird diese Wahrnehmung durch die Entwicklungen der Medienwelt in den letzten Jahrzehnten (z. B. die Verdrängung des Radios durch das Fernsehen). Die Nutzung von Hörmedien beschränkt sich zunehmend auf Situationen, in denen Menschen keine visuellen Medien nutzen können (z. B. Joggen). Im Sinne eines kompensatorischen Ansatzes ist es daher grundsätzlich sinnvoll, dem Hören mehr Aufmerksamkeit zu schenken, es zu stärken und zu fördern. Natürlich ist der Einsatz im Unterricht nur förderlich, solange es dem Unterrichtsgegenstand dient. Ein konzentriertes Zuhören schafft die Möglichkeit, mehrere Dimensionen des Hörmediums gleichzeitig wahrzunehmen. Dazu gehören beispielsweise Informationen des/r Sprechenden, Begleitgeräusche oder die Art der Atmosphäre. Durch den Einsatz von Hörmedien kannst du somit die akustische Wahrnehmung von Schüler:innen gezielt fördern. Die Möglichkeiten eines akustischen Mediums sind jedoch erst dann vollkommen ausgeschöpft, wenn dieses mehr bietet als lediglich Sachinformationen, die von einem/r Sprechenden vorgetragen werden. Diese Voraussetzung solltest du bei der Auswahl und Darbietung von Hörmedien unbedingt berücksichtigen.
Das Auge hat sich im täglichen Leben zum dominanten Sinnesorgan entwickelt. Demgegenüber ist das Ohr und damit das Hören ein eher untergeordnetes Sinnesorgan. Verstärkt wird diese Wahrnehmung durch die Entwicklungen der Medienwelt in den letzten Jahrzehnten (z. B. die Verdrängung des Radios durch das Fernsehen). Die Nutzung von Hörmedien beschränkt sich zunehmend auf Situationen, in denen Menschen keine visuellen Medien nutzen können (z. B. Joggen). Im Sinne eines kompensatorischen Ansatzes ist es daher grundsätzlich sinnvoll, dem Hören mehr Aufmerksamkeit zu schenken, es zu stärken und zu fördern. Natürlich ist der Einsatz im Unterricht nur förderlich, solange es dem Unterrichtsgegenstand dient. Ein konzentriertes Zuhören schafft die Möglichkeit, mehrere Dimensionen des Hörmediums gleichzeitig wahrzunehmen. Dazu gehören beispielsweise Informationen des/r Sprechenden, Begleitgeräusche oder die Art der Atmosphäre. Durch den Einsatz von Hörmedien kannst du somit die akustische Wahrnehmung von Schüler:innen gezielt fördern. Die Möglichkeiten eines akustischen Mediums sind jedoch erst dann vollkommen ausgeschöpft, wenn dieses mehr bietet als lediglich Sachinformationen, die von einem/r Sprechenden vorgetragen werden. Diese Voraussetzung solltest du bei der Auswahl und Darbietung von Hörmedien unbedingt berücksichtigen.
Darauf solltest du achten

- gut verständliche Texte auswählen
- Redundanz erlaubt
- Vermeiden von: komplexen Textstrukturen, langen Schachtelsätzen und vielen Fremdwörtern 🡪 Überforderung des Zuhörens
- kurze Sequenzen am Stück präsentieren
- vor allem bei jüngeren Schülern oder wenig homogenen Lerngruppen
- Präsentation immer wieder pausieren, um Verständnis des bisher Gehörten abzusichern
- Wissenssicherung
- Verschriftlichung/Skizzierung des Gehörten 🡪 effektive Lernstrategie
- flüchtige Informationen werden so dauerhaft verfügbar
- Förderung des kognitiven UND affektiven Lernens durch
- atmosphärisch interessante Hörmedien (z. B. Reportagen mit O-Tönen) oder gut inszenierte Hörspiele
- spannende Hörerlebnisse motivieren Schüler, sich mit einem Thema zu beschäftigen
Anregungen für den Einsatz von Audiomedien
Fach/Fächerkombination
Medium
Herkunft
Geschichte
- historische Reden im O-Ton
- historische Rundfunksendungen
- Interviews zu historischen Themen
- Auszüge aus Hörbüchern (historische Romane, Biografien, etc.)
- Deutsches Rundfunkarchiv
- Rundfunkprogramme
- Lebendiges Museum online (siehe Web-Tipps)
- Hörbuchverlage
Politik
Sozial- und Gemeinschaftskunde
Erdkunde
- Hörbücher (Sachbücher)
- Reportagen
- Features zu sozialen Themen
- Ausschnitte aus politischen Debatten oder wichtigen Reden
- Rundfunkprogramme
- Hörbuchverlage
- Mediathek der Bundesregierung
- Bundeszentrale für politische Bildung
Naturwissenschaften/Mathematik
- naturwissenschaftliche Reportagen und Berichte
- Hörbücher (z. B. Jugendsachbücher)
- Rundfunkprogramme
- Hörbuchverlage
Religion/Ethik
- Hörfunkbeiträge zu sozialen Themen
- Jugendliteratur
- Hörspiel
- Rundfunkprogramme
- Hörbuchverlage
Kunst/Musik
- Künstler- oder Komponistenportraits
- Musikalisch relevante Hörspiele
- Soundscapes/Klangbilder für fächerübergreifenden Unterricht
- Rundfunkprogramme
- Tonträger

Rundfunknachrichten
Die Auswahl, Gewichtung und Präsentation von Nachrichten beeinflussen erheblich unsere Vorstellung, welche Teile des Weltgeschehens als wichtig wahrgenommen werden! Diese Unterschiede sollen von den Schüler:innen erfasst werden.
![]() Arbeitsblatt Audio Rundfunknachrichten
Arbeitsblatt Audio Rundfunknachrichten
Praxisbeispiel für den Unterricht
Ziel: Die Erfassung von Unterschieden zwischen verschiedenen Nachrichtensendungen
- Untersuchung von zwei Nachrichtensendungen
- Sender müssen sich deutlich in ihrer Hörerschaft unterscheiden
- Nachrichtensendungen werden aufgenommen
- Sendungen müssen zum gleichen Zeitpunkt ausgestrahlt werden
- detaillierter Vergleich

🡪 umfassende Themenseite zu den Bereichen Hörerziehung, Hörmedien für Kinder und Jugendliche, Veranstaltungen, Termine etc.
🡪 LeMO: Lebendiges Museum Online
🡪 Gemeinschaftsprojekt der Stiftung „Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“ (HdG)in Bonn und des Deutschen Historischen Museums (GHM) in Berlin
🡪 umfassendes Angebot an Film- und Tondokumenten
🡪 umfassende Linksammlung zu historischen Audiomedien findet sich im Bereich Sekundarstufen/Geschichte
🡪 Mediathek enthält u. a. Podcasts und Audio-Stream zu aktuellen politischen Themen
→ www.migration-audio-archiv.de
🡪 Sammlung mit Erzählungen von Migranten über ihren Lebensweg
→ http://hoerspiele.dra.de/index.php
🡪 ARD Hörspieldatenbank verzeichnet alle ARD-Hörspiele seit 1945
→ https://www.ardaudiothek.de/
🡪 ARD Audiothek: verschiedenste Hörspiele, Features und Podcasts der ARD
→ https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/medienwerkstatt/multimedia/audio/
🡪 Lehrerfortbildungsportal des Landes Baden-Württemberg
🡪 enthält u. a. Anleitungen für Audio-Software und Informationen zu verschiedenen Audioformate

Gehe auf die Website: → www.kahoot.it und gibt die folgende GAME-PIN ein: 08870881.
Diese Quiz wird dich dabei unterstützen, das soeben Gelernte zu festigen. Wir wünschen dir viel Spaß!
2 Film und Fernsehen
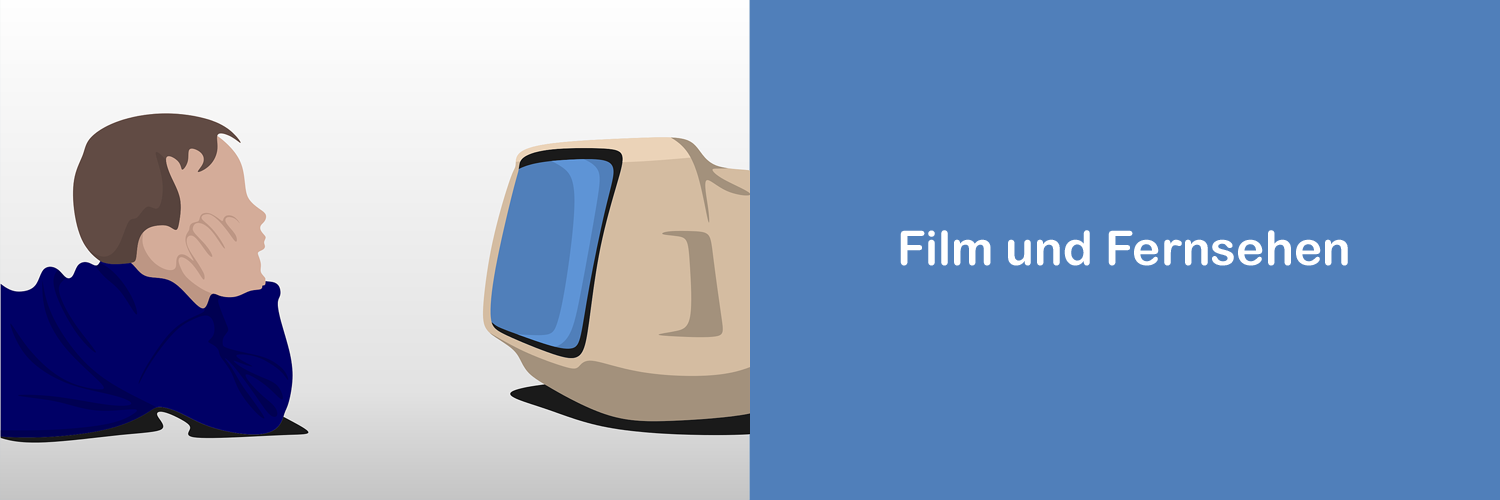
Willkommen zum zweiten Teilbereich – Film und Fernsehen.
Audiovisuelle Medien wie Kino, Fernsehen und Video dominieren die Umwelt von Kindern und Jugendlichen. Im Fokus der Film- und Fernsehbildung sollte daher nicht nur die theoretische Aneignung stehen, sondern auch praktische Übungen integriert werden.
Der Film und das Fernsehen sollten im Rahmen einer schulischen Medienkunde einen eigenständigen Platz einnehmen. Das Medium Film ist bereits in den Bildungsplänen der Bundesländer verankert. Dabei ist nicht nur die inhaltliche Auseinandersetzung relevant. Bilder zu entschlüsseln und sich über die Wirkungsweisen der Gestaltungsmittel bewusst zu werden, sollten zu den Fähigkeiten und Fertigkeiten heutiger Schüler:innen gehören. Die Nutzung des Films und des Fernsehens sollte hierbei nicht nur auf einzelne Fächer beschränkt sein, sondern innerhalb des gesamten Fächerkanons zum Einsatz kommen.
Theoretische Grundlagen: Film und Fernsehen in der Unterrichtspraxis
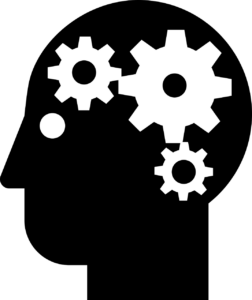
Die Fähigkeit, audiovisuelle Konventionen zu entschlüsseln, hilft Schüler:innen im Umgang mit den Medien Film und Fernsehen selbst, ist jedoch auch relevant für den Umgang mit anderen medialen Texten. Zumeist beschränkt sich der Einsatz von Film und Fernsehen auf bestimmte pädagogische Zusammenhänge:
- als Material im Geschichts- oder Deutschunterricht (zur Illustration eines Themas)
- als Lehrfilm in naturwissenschaftlichen Fächern oder Erdkunde
- als pädagogisch wertvolle Filme oder Serien (stoßen selten auf Anklang bei Lernenden)
Besonders das Fernsehen ist nach wie vor ein äußerst populäres Medium. Es ist für Kinder und Jugendliche aber nicht nur ein Unterhaltungsmedium, sondern dient auch als Informationsquelle und Orientierungshilfe. Schüler und Schülerinnen erfahren das „richtige Leben“ nicht nur über die Primärwelt, in Form von realen Erlebnissen, sondern auch über die Sekundärwelt, zum Beispiel in Form des Fernsehens. Oftmals wird auch die Kommunikation unter Jugendlichen maßgeblich durch das Fernsehen beeinflusst. Die ständige Verfügbarkeit führt dazu, dass es oftmals wahllos und in großen Mengen konsumiert wird.
Du musst als Lehrkraft nicht davor zögern, Filme und Serien in deine Unterrichtsgestaltung einfließen zu lassen. Im Rahmen des Unterrichts können ganz unterschiedliche Aspekte genauer analysiert werden, wie z. B. die Erzählstruktur oder die Figurenentwicklung. Durch den Einsatz von Filmen und Serien haben die Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit, einen neuen Blick auf ein von ihnen geschätztes Medienprodukt zu gewinnen und dieses besser zu verstehen. Die Aufgabe der Medienbildung besteht daher unter anderem darin, einen kompetenten Umgang mit dem Medium Fernsehen zu vermitteln. Dadurch können die Schüler:innen ihre außerschulischen Erfahrungswelten konstruktiv in den Unterricht einbringen. Es ist hierbei wichtig, dass du dich als Lehrkraft auf die Erlebniswelten der Lernenden einlässt.
Darauf solltest du achten
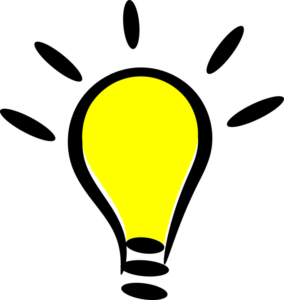 Der Film ist durch seine Popularität und seinen Unterhaltungswert anderen Unterrichtsmedien oft weit voraus. Er ermöglicht eine unmittelbare und unverstellte Wahrnehmung einer erzählten Geschichte. Durch den Einsatz von Filmen im schulischen Kontext können Lernprozesse akustisch-visuell optimiert werden und somit einen Beitrag zur reflektierten Wahrnehmung und Bildung der Lernenden leisten. Im Folgenden findest du ein paar Hilfestellungen für einen geeigneten Einstieg in die Arbeit mit Filmen
Der Film ist durch seine Popularität und seinen Unterhaltungswert anderen Unterrichtsmedien oft weit voraus. Er ermöglicht eine unmittelbare und unverstellte Wahrnehmung einer erzählten Geschichte. Durch den Einsatz von Filmen im schulischen Kontext können Lernprozesse akustisch-visuell optimiert werden und somit einen Beitrag zur reflektierten Wahrnehmung und Bildung der Lernenden leisten. Im Folgenden findest du ein paar Hilfestellungen für einen geeigneten Einstieg in die Arbeit mit Filmen
- kommunikationsorientierte Methoden, wie z. B. Brainstorming
- Festhalten von spontanen Gedanken zu: Filminhalt, Filmtechnik, stilistischen Mitteln, Figuren etc. 🡪 Die Lernenden lernen frei und spontan zu sprechen und zu argumentieren.
- einzelne Sequenzen des Films vorführen
- Ansehen von Anfangssequenzen des Films 🡪 Die Lernenden stellen Hypothesen zum weiteren Handlungsverlauf auf.
- Vergleich mit der literarischen Vorlage zum Film (falls vorhanden) 🡪 Die Lernenden lesen zunächst den dazugehörigen Ausschnitt im Buch und überlegen sich dann wie man den Ausschnitt im Film umsetzen könnte. Anschließend wird die Szene zusammen angeschaut und die Ergebnisse verglichen.
- Ansehen eines Films im Kino
- ist nach wie vor ein besonderes Erlebnis – für Groß und für Klein 🡪 Die Lernenden können analysieren, wie der Film gestaltet wurde und welche Wirkung dadurch hervorgerufen wird.
- extra Bonus: du ermöglichst den Schüler:innen einen kleinen Tapetenwechsel von den täglichen Klassenräumen
Anregungen für den Einsatz von Filmen
Schulfach
Film
Kompetenzen
Deutsch
Spielfilme, Literaturverfilmungen
Filmanalyse, filmische Erzählstrukturen
Geschichte
Spielfilme, Dokumentationen
Filmgeschichte als Teil der Kulturgeschichte, Film als historische Quelle
Kunst
Spielfilme, Videoclips, Werbung, Musikclips, Fernsehsendungen
Film als Kunstgattung, ästhetische Komponente
Musik
Musikfilm, Videoclips
Rolle und Funktion der Filmmusik, Zusammenspiel von Bild und Ton
Fremdsprachen
Spielfilme, Dokumentationen, Fernsehsendungen, Musikclips
Hörverständnis, sprachanalytische Aufgabenstellungen
Politik / Sozialkunde
Spielfilme, Dokumentationen, Fernsehmagazine, Nachrichten
Film als Ideologieträger, Film als Teil der Mediendemokratie
Religion / Ethik
Spielfilme, Dokumentationen, Fernsehfilm
Film als vielschichtige Erzählung, Darstellungsweisen und Aussagen
Erdkunde
Dokumentationen, Fernsehsendungen, Nachrichten, Spielfilme
reflektierter Umgang mit Medien als Informationsquelle
Naturwissenschaften
Dokumentationen, Nachrichtensendungen, Spielfilme
Auseinandersetzung mit medialer Darstellung naturwissenschaftlicher Phänomene, Film als Technologie
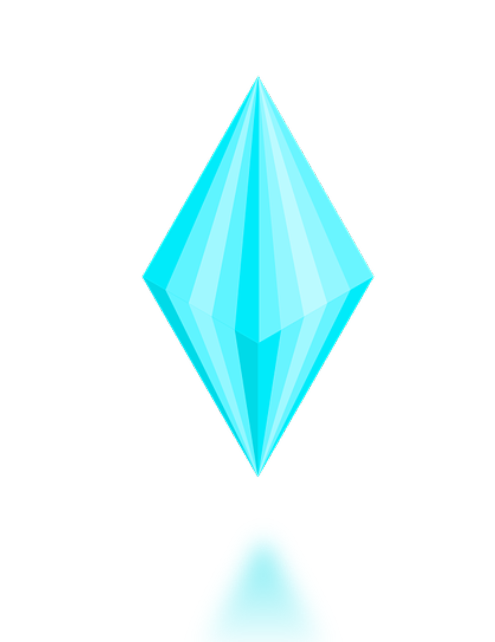
![]() Arbeitsblatt Film und Fernsehen Fernsehgewohnheiten
Arbeitsblatt Film und Fernsehen Fernsehgewohnheiten
Fernsehgewohnheiten
Als Einstieg in eine Unterrichtseinheit zum Thema Fernsehen eignet sich beispielsweise eine Programmanalyse, daher die Beschäftigung mit den unterschiedlichen Formaten und ihren Merkmalen. Die Schüler werden dadurch für ihre eigenen Fernsehgewohnheiten sensibilisiert. Die Lernenden sollten sich die unterschiedlichen Typen von Fernsehsendungen vergegenwärtigen.
Dadurch kann sich auch der Umfang und Inhalt des eigenen Fernsehkonsums besser bewusst gemacht werden.
(1) Unterhaltungssendungen
- sehr vielfältig und bei Jugendlichen beliebt
- umfassen Quizsendungen, Gameshows, Castingshows, Sportsendungen etc.
(2) Informationssendungen
- Nachrichtensendungen aller Art, Magazine, Reportagen, Dokumentationen etc.
- klassische Nachrichtensendung informiert Zuschauer neutral über aktuelle Geschehnisse (unterlegt von Live-Interviews oder Liveschaltungen)
- Infotainment 🡪 Sendungen, die Zuschauer informieren und unterhalten sollen
(3) Fiktionale Sendungen
- Spielfilme, Serien, sendereigene Fernsehfilme
- Klassiker der Filmgeschichte
- Episodenserien (in sich abgeschlossene Handlungen pro Folge) und Fortsetzungsserien (kontinuierlicher Handlungsfaden)

In allen Bundesländern werden in regelmäßigen Abständen sogenannte „Schulkinowochen“ durchgeführt. Dort können Klassen aller Altersstufen ein auf den Lehrplan abgestimmtes Filmprogramm in den Kinos vor Ort besuchen. Um die Filme vor- und nachzubereiten, werden den Schulen sogar kostenlose Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt und unter anderem Fortbildungen für Lehrkräfte veranstaltet. Dein Interesse ist geweckt? Schau dir gern einmal den dazugehörigen Link für weitere Informationen an: → visionkino.de.

Aufgabe: Überlege dir, wie du deine Schülerinnen und Schüler dazu bewegst, vom Konsumenten zum Produzenten zu werden. Plane für jedes deiner Unterrichtsfächer ein kleines Projekt, in dem die Schüler eigenständig einen Kurzfilm erstellen sollen.
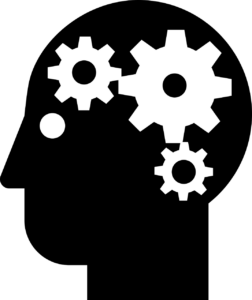 Die aktive Medienarbeit, in der die Lernenden vom Konsumenten zum Produzenten werden, kann innerhalb aller Unterrichtsfächer durchgeführt werden. Sie fördert dadurch eine kreative, selbstständige und vor allem nachhaltige Erarbeitung von Lernplaninhalten. Die in einem Film oder Kurzfilm umgesetzten visualisierten Zusammenhänge bleiben wesentlich länger im Gedächtnis der Schüler:innen erhalten. So lassen sich kommunikative Fähigkeiten und die Eigeninitiative auf unterhaltsame und dennoch informative Art und Weise fördern. Gern kannst du auch deine Kollegen und Kolleginnen einbeziehen, um fächerübergreifend zu arbeiten.
Die aktive Medienarbeit, in der die Lernenden vom Konsumenten zum Produzenten werden, kann innerhalb aller Unterrichtsfächer durchgeführt werden. Sie fördert dadurch eine kreative, selbstständige und vor allem nachhaltige Erarbeitung von Lernplaninhalten. Die in einem Film oder Kurzfilm umgesetzten visualisierten Zusammenhänge bleiben wesentlich länger im Gedächtnis der Schüler:innen erhalten. So lassen sich kommunikative Fähigkeiten und die Eigeninitiative auf unterhaltsame und dennoch informative Art und Weise fördern. Gern kannst du auch deine Kollegen und Kolleginnen einbeziehen, um fächerübergreifend zu arbeiten.
Computer und Internet
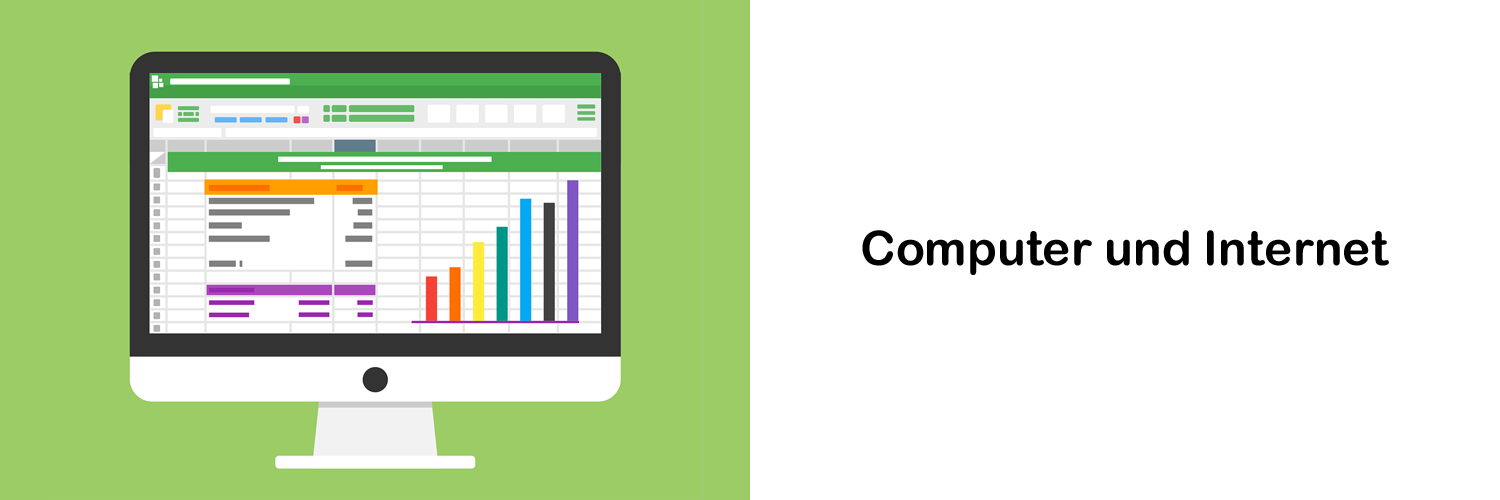
Willkommen zum dritten Teilbereich – Computer und Internet.
Theoretische Grundlagen: richtig recherchieren
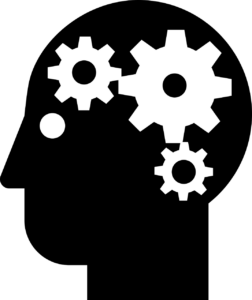 Durch die Ausbreitung des Internets stehen Schülerinnen und Schülern jede Menge Informationen zur Verfügung. Die Schwierigkeit liegt also nicht im Finden von Informationen, sondern in der Auswahl und dem Bewerten. Denn mit der Zunahme an verfügbaren Informationen steigt keineswegs auch die Verlässlichkeit und Qualität von diesen. Unterschiede zwischen brauchbaren und unbrauchbaren Informationen zu erkennen, ist eine wesentliche Voraussetzung für eine gelungene Internet-Recherche. Hilfreich sind hierbei einige Kriterien, welche stets überprüft werden sollten (siehe „Arbeitsblatt Web-Check“).
Durch die Ausbreitung des Internets stehen Schülerinnen und Schülern jede Menge Informationen zur Verfügung. Die Schwierigkeit liegt also nicht im Finden von Informationen, sondern in der Auswahl und dem Bewerten. Denn mit der Zunahme an verfügbaren Informationen steigt keineswegs auch die Verlässlichkeit und Qualität von diesen. Unterschiede zwischen brauchbaren und unbrauchbaren Informationen zu erkennen, ist eine wesentliche Voraussetzung für eine gelungene Internet-Recherche. Hilfreich sind hierbei einige Kriterien, welche stets überprüft werden sollten (siehe „Arbeitsblatt Web-Check“).
Die Erfahrung von Pädagoginnen und Pädagogen zeigen, dass selbst die sogenannten „Digital Natives“ noch Schwierigkeiten in Bezug auf die Recherchekompetenz aufweisen. Um gezielt nach Wissen und Informationen zu suchen, müssen die Lernenden zunächst wissen, worin ihr Rechercheziel besteht. Bei der Weiterverarbeitung der gefundenen Informationen sind wichtige Fragen zu beantworten: Sind die Informationen zuverlässig? Ergeben sich dadurch neue Fragen? Wie kann ich die Informationen mit meinem vorhandenen Wissen verknüpfen? Recherchieren ist ohne Zweifel eine anspruchsvolle Aufgabe, die jedoch zu den Grundfähigkeiten eines Menschen des 21. Jahrhunderts gehört.
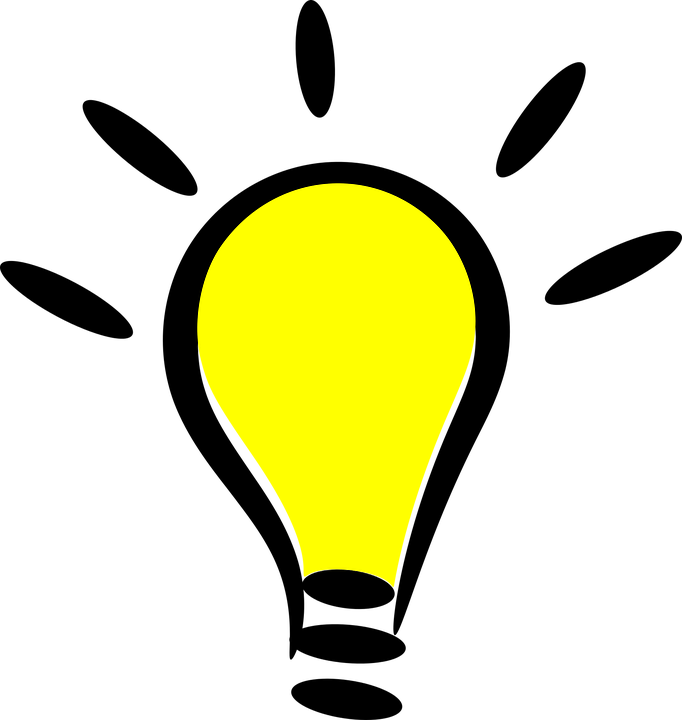
![]() Arbeitsblatt „Computer und Internet Web-Check“
Arbeitsblatt „Computer und Internet Web-Check“
In dieser Übersicht findest du auf Seite 2 eine Checkliste mit wichtigen Kriterien. Darin werden die Fragen
- Wer steckt dahinter?
- Was will die Seite erreichen
- Qualität der Inhalte
- Gestaltung, äußeres Erscheinungsbild
detailliert aufgeschlüsselt.
Darauf solltest du achten
Damit die recherchierten Informationen sinnvoll festgehalten bzw. präsentiert werden können, bedarf es einiger Grundlagen in Bezug auf Computeranwendungen.
(1) Textverarbeitung
Ein Textverarbeitungsprogramm zu beherrschen, ist Voraussetzung für ein Studium und die meisten Berufe. Warum also nicht bereits während der Schulzeit anfangen, solche Fähigkeiten und Fertigkeiten zu fördern? Schüler und Schülerinnen sollten zum Beispiel in der Lage sein, eine Facharbeit am Computer zu verfassen. Dazu gehört nicht nur der reine Fließtext, sondern auch der Einsatz von Fußnoten und Seitenzahlen, das Beachten formaler Vorgaben oder die Einbettung von Bildern und Grafiken. Gleiches gilt zum Beispiel auch für ein Handout, welches einem Referat der Klasse zur Verfügung gestellt werden kann. Dadurch lernen die Schülerinnen und Schüler, Inhalte sinnvoll zu strukturieren und die Verständlichkeit durch das Zusammenspiel von Bild und Text zu erhöhen.
(2) Internet-Browser
Seien wir ehrlich. Der Umgang mit dem Internet dürfte fast allen Schüler:innen bekannt sein. Aber auch in Bezug auf das World Wide Web gibt es noch Defizite in puncto Einstellungen zur persönlichen Datensicherheit. Ein Thema, welches heutzutage immer wichtiger wird.
 Einige Grundlagen findest du auf folgender Website: → Klicksafe. Außerdem findest du weitere Informationen zum Thema „Datenschutz in der Schule“ → hier.
Einige Grundlagen findest du auf folgender Website: → Klicksafe. Außerdem findest du weitere Informationen zum Thema „Datenschutz in der Schule“ → hier.
(3) Präsentations-Software
Welcher Schüler und welche Schülerin hat es noch nicht erlebt? Der Vortrag wurde durch Computerpannen unterbrochen, das Format der Folien ist bei der Übertragung verrutscht oder die Anordnung von Text und Bild ist viel zu konfus. Hier ist die Devise: „Übung macht den Meister“! Die Klasse sollte gemeinsam nach einem Referat die dazugehörige Präsentation auswerten – natürlich konstruktiv. Was war gut umgesetzt? Was kann man besser machen? Der gegenseitige Austausch mit den Gleichaltrigen und dein professioneller Input werden den Schüler:innen auf ihrem weiteren Weg maßgeblich helfen.
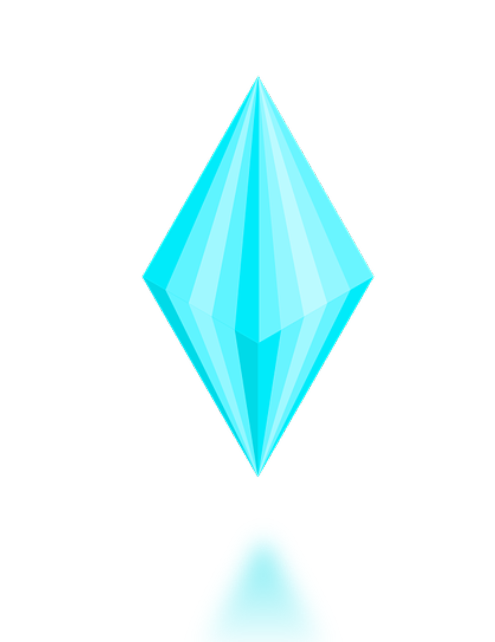
Du solltest nicht die Kommunikation unter Gleichaltrigen unterschätzen. Wie wäre es also mit der Idee, Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Ländern zusammenführen? Der Schriftverkehr in der jeweiligen Muttersprache ist motivierend und schult die Sprach- und Schreibkompetenzen der Lernenden. Solche Kooperationen erfordern natürlich durchaus einige Vorplanung. Du kannst dir aber sicher sein, dass es sich auf jeden Fall lohnen wird! Bei der Suche nach geeigneten Partnern können dir die folgenden Websites helfen.
→ Der Tandem-Server der Ruhr-Universität Bochum vermittelt Einzel- und Gruppenpartnerschaften.
→ Das Projekt „eTwinning“ des Vereins „Schulen ans Netz“ fördert internetbasierte, internationale Kooperationen zwischen Schulen.
Gutes Recherchieren (mit dem Arbeitsblatt „Computer und Internet Web-Check”)
Um herauszufinden, was die weite Welt des Internets zu bieten hat, gehen die Schüler und Schülerinnen an verschiedenen Stellen auf die Suche:
- bei Wikipedia
- bei Kindersuchmaschinen wie → www.blinde-kuh.de oder → www.fragfinn.de
- in einem Jugendlexikon
- in einem klassischen Lexikon (z. B. Brockhaus)
🡪 Anschließend wird verglichen: Welche Informationen werden geboten? Wie sind sie strukturiert? Worin bestehen Unterschiede? Welche Angebote sind besonders ausführlich? Wo finde ich passende Bilder?
🡪 Wenn Schüler und Schülerinnen einen solch systematischen Vergleich nur an wenigen Beispiele durchführen, bekommen sie einen guten Eindruck davon, welche Vor- und Nachteile die einzelnen Informationsquellen haben.
 Jetzt bist du an der Reihe! Wie wäre es, wenn du einmal selbst die Checkliste anhand der unten aufgeführten Websites zum Lehrplan-Thema „Drogen” austestest? Benutze dafür einfach die Checkliste aus dem Kapitel der theoretischen Grundlagen. Gern kannst du auch das dazugehörige Arbeitsblatt verwenden, um deine Ergebnisse festzuhalten.
Jetzt bist du an der Reihe! Wie wäre es, wenn du einmal selbst die Checkliste anhand der unten aufgeführten Websites zum Lehrplan-Thema „Drogen” austestest? Benutze dafür einfach die Checkliste aus dem Kapitel der theoretischen Grundlagen. Gern kannst du auch das dazugehörige Arbeitsblatt verwenden, um deine Ergebnisse festzuhalten.
 Was meinst du? Welche Kriterien sollten vielleicht noch der Checkliste („Arbeitsblatt Computer und Internet Web-Check”) hinzugefügt werden? Nutze dafür die unten aufgeführten Websites, die dir noch weiteres Info-Material bieten. Lass uns und andere Lehrkräfte gern in den Kommentaren wissen, was du herausgefunden hast!
Was meinst du? Welche Kriterien sollten vielleicht noch der Checkliste („Arbeitsblatt Computer und Internet Web-Check”) hinzugefügt werden? Nutze dafür die unten aufgeführten Websites, die dir noch weiteres Info-Material bieten. Lass uns und andere Lehrkräfte gern in den Kommentaren wissen, was du herausgefunden hast!
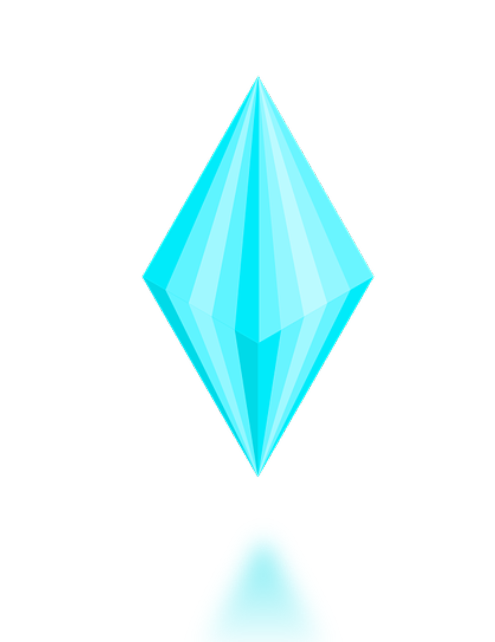
Barg, W., Niesyto, H., & Schmolling, J. (2005). Jugend – Film – Kultur. Grundlagen und Praxishilfen für die Filmentwicklung. München: kopaed.
Bergala, A. (2006). Kino als Kunst: Filmvermittlung an der Schule und anderswo. Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung.
Blothner, D. (1999). Erlebniswelt Kino: über die unbewußte Wirkung des Films. Bergisch Gladbach: Bastei-Verlag Lübbe.
Breiter, A., Aufenanger, S., Averbeck, I., Welling, S., & Wedjelek, M. (2013). Medienintegration in Grundschulen: Untersuchung zur Förderung von Medienkompetenz und der unterrichtlichen Mediennutzung in Grundschulen sowie ihrer Rahmenbedingungen in Nordrhein-Westfalen. Berlin: Vistas-Verl.
Fußmann, A. (2003). Medienbildung: Beiträge aus Theorie und Praxis von Schule und Jugendarbeit. Nürnberg: Emwe-Verl.
Haller, M. (2017). Methodisches Recherchieren. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH.
Henzler, B. (2010). Vom Kino lernen: Internationale Perspektiven der Filmvermittlung. Berlin: Bertz + Fischer.
Kaiser, M. (2015). Recherchieren: Klassisch – online – crossmedial. Wiesbaden: Springer VS.
Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. (k.D). Medienbildung. Überblick über die Medienbildung und die Mediendidaktik mit Definitionen und Methodenbeispielen für die Praxis. Online abgerufen unter: https://www.lmz-bw.de/medien-und-bildung/medienwissen/medienbildung/ [07.01.2021]
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.). (2020). JIM-Studie 2020. Jugend, Information, Medien. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-jähriger. Online abgerufen unter: https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2020/JIM-Studie-2020_Web_final.pdf [11.01.2020].
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.). (2018). KIM-Studie 2018. Kindheit, Internet, Medien. Basisuntersuchung zum Medienumgang 6- bis 13-jähriger. Online abgerufen unter: https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/KIM/2018/KIM-Studie_2018_web.pdf [11.01.2020].
Moegling, K., Fichtner-Gade, P., & Stamm, R. (2004). Didaktik selbstständigen Lernens: Grundlegung und Modelle für die Sekundarstufen I und II. Bad Heilbrunn/Obb: Klinkhardt.
Sächsisches Staatsministerium für Kultus. (k. D.). Schulische Medienbildung. Online abgerufen unter: https://www.medienbildung.sachsen.de/schulische-medienbildung-4494.html [08.01.2020].
Schepers, P., & Wetekam, B. (2012). Handbuch Medienkunde. Konzeption und praktische Umsetzung schulischer Medienbildung. Braunschweig: Westermann.
Tulodziecki, G. (2019). Medienbildung in Schule und Unterricht: Grundlagen und Beispiele. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Du hast es geschafft. Du bist jetzt gewissermaßen Profi für digitale Medienformate in der Unterrichtspraxis. Wir freuen uns, dass du diese Lerneinheit absolviert hast und hoffen, dass du dadurch ein paar Eindrücke bekommen hast, wie du zukünftig die unterschiedlichen digitalen Medien in deinem Unterricht einsetzen kannst.
Wir wünschen dir viel Erfolg!
Diese Lerneinheit wurde von Anne K. für dich erstellt.
Impressum
Kristin Narr
Dittrichring 17
04109 Leipzig
mail@kristin-narr.de
kristin-narr.de
Kontakt
Kristin Narr
Dittrichring 17
04109 Leipzig
Kontakt: mail@kristin-narr.de
Datenschutzerklärung
Unsere Datenschutzerklärung findet ihr in voller Länge auf der Seite Fragen und Antworten. Hier geht es zur Seite: → Fragen und Antworten
